Ohne ‘purpose’ geht’s ebenso
Weshalb mit dem Warum beginnen? Ohne purpose geht’s auch. »Beginne mit dem Warum« ist der griffige Slogan des ehemaligen Werbemannes1 Simon Sinek. Geht ohne purpose nichts
digitalien.org — Stefan Knecht
Ab der Spätrenaissance kamen Wunderkammern in Mode. Ein geordnetes Panoptikum aus Gemälden, Kunsthandwerk, ausgestopften Tieren und was auch immer von gefährlichen Reisen den langen Weg zurück zu Hofe überstand. Anfassbare Artefakte anderer Welten.
In der postfaktischen Gegenwart wiegt ‘Bauchgefühl’ schwerer als Evidenz.
Sollte man ihm trauen?
↯kne:buster betrachtet Mythen, Glaubenssätze und Mißverständnisse im wilden Westen zwischen Organisation, ‘New Work’ und Küchenpsychologie. Auch eine Wunderkammer.
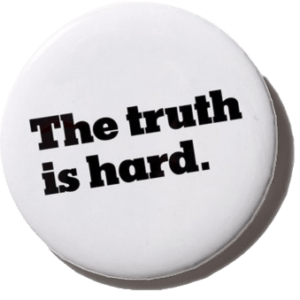 Manche ↯kne:buster Texte wurden zu einem Podcast in der Expedition Arbeit. Mit auch illustren Gästen zerlegten Stefan Knecht und Alexander Jungwirth freundlich-skeptisch ein Thema.
Manche ↯kne:buster Texte wurden zu einem Podcast in der Expedition Arbeit. Mit auch illustren Gästen zerlegten Stefan Knecht und Alexander Jungwirth freundlich-skeptisch ein Thema. Meist Hin und wieder unterhalb 20 Minuten. Die Ergebnisse können Sie nachhören bei jedem gut sortierten Podcast-Aggregator.
edit: Irgendwann hatte der Spaß dann ein Loch. Nicht die Themen gingen aus, sondern die Freude am Zerlegen halbgarer Glaubenssätze. Nach wenigen Versuchen über funktionierende, evidente Praktiken mit ebenso kompetenten Menschen zu sprechen ging das Podcasten dann einem Ende entgegen.

Weshalb mit dem Warum beginnen? Ohne purpose geht’s auch. »Beginne mit dem Warum« ist der griffige Slogan des ehemaligen Werbemannes1 Simon Sinek. Geht ohne purpose nichts
Sind wir stets neugierig[1] und bestens informiert, um rationale Entscheidungen zu treffen? Oder sind wir Menschen doch keine ‘Informavoren’[2][3] Wie kann es sein, dass wir absichtlich Informationen vermeiden um — von lästigen Fakten ungestört — längst gefasste Meinungen zu pflegen? Erstaunlich oft schauen Menschen absichtlich weg, vermeiden Informationen um in bewusster Ignoranz selbstdienliche Entscheidungen zu treffen. Im Glauben verharren obwohl Fakten dagegen sprechen? Finsterstes Mittelalter!
SAFe — Vertrauen, Glauben und magisches Denken Liefert SAFe tatsächlich so erhebliche Verbesserungen wie behauptet? Her mit den Rohdaten, da schauen wir doch gerne unter die
Alles egal: das Skalierungsframework macht keinen Unterschied Wie Veränderung am Besten geht, wie Wandel kommt und bleibt? Genau weiss das niemand, es gibt mehr Meinungen
SAFe — Wieviel Besser ist plausibel? Frameworks wie LeSS oder SAFe versprechen die Skalierung der im Kleinen funktionierenden agilen Methoden und Praktiken auf größere Vorhaben oder
Sind wir stets neugierig[1] und bestens informiert, um rationale Entscheidungen zu treffen? Oder sind wir Menschen doch keine ‘Informavoren’[2][3] Wie kann es sein, dass wir absichtlich Informationen vermeiden um — von lästigen Fakten ungestört — längst gefasste Meinungen zu pflegen? Erstaunlich oft schauen Menschen absichtlich weg, vermeiden Informationen um in bewusster Ignoranz selbstdienliche Entscheidungen zu treffen. Im Glauben verharren obwohl Fakten dagegen sprechen? Finsterstes Mittelalter!
Mitarbeitergespräche? Super Sache. Oh wait … wofür? Die Bewertungssaison läuft! Jedem braven Angestellten winkt ein jährliches ‘Mitarbeitergespräch’. Nach einem Gesprächsleitfaden befragt ein Angestellte/r eine/n anderen.
Wissen, Glauben und Schrödingers Kühlschrank Wissenschaft beruht auf Belegen und Kontrollen, nicht auf Glauben oder Vertrauen: man stellt eine Theorie auf und versucht sie mit
Was ist dran an beliebten Glaubenssätzen des Change Management? Wie filtert man aus einem Meer markiger statements, was tatsächlich fundiert ist? In diesem Beitrag geht
Dieser Beitrag ordnet den Loop-Approach als Vorgehen zu Organisationsveränderungen methodisch ein. In der Summe entsteht eine kritische Bewertung: der Loop-Approach erscheint als unkonzertierte Mischung aus
Aufgemerkt! Der Dunning-Kruger Effekt stimmt nur zu einer Hälfte In den 1990ern prüften David Dunning und Justin Kruger, ob inkompetente Personen sich ihrer Unfähigkeit bewusst
Der Hawthorne-Effekt ist keiner. Von den vielen Mythen der angewandten Küchen- und Industriepsychologie ist der Hawthorne-Effekt einer der älteren und darf auch ins Altpapier: wer
bei allen gut sortierten Podcastplattformen und: Spotify
Quellen und Hinweise:Diese Folge mit Alexander Jungwirth und Stefan Knecht geht tiefer in die Umstände für ‘Psychological Safety’. Sicherheit als Gegenteil von Geborgenheit? Kann es das denn geben in Unternehmen?
Ein Trio-kne:buster-Folge mit Florian Städtler:
In dieser kne:buster-Folge »Lernen und Kompetenz« sprechen Alexander Jungwirth und Stefan Knecht über ebendas: wie Kompetenzen entstehen und aus Einsteigern Experten werden. Experten werden können — wenn ein paar Randbedingungen passen.
»Kompetenz entwickelt sich nicht durch Einsicht sondern durch emotionale Labilisierung: in Beziehung gehen, sich öffnen — Vertrauen haben etwas zu tun, was man sonst nicht tut.« — (Arnold 2015)
TL;DR? ( »too long, didn’t read«) kleiner Anreisser-Beitrag:
Die Guglhupf-Analogie: wie lernen Menschen?
Arnold, Rolf. 2015. “Wie man führt, ohne zu dominieren – Wie man lehrt, ohne zu belehren” https://youtu.be/5CdcCFd7JGY 48min, Vortrag am 5. KATA-Praktikertag am 20.11.2015 Stuttgart
Benner, Patricia E., Christine Tanner, and Catherine Chesla. 1992. ‘From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice’. Advanced Nursery Science, 14(3), , 13–28.
Bloom, Benjamin S., and Lauren A. Sosniak, eds. 1985. Developing Talent in Young People. 1st ed. New York: Ballantine Books. 978-0-345-31951-7 978-0-345-31509-0
Dreyfus, H. & Dreyfus, St. (1986/87). Künstliche Intelligenz. Von den Grenzen der Denkmaschine und dem Wert der Intuition. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt. (Orig.: Mind Over Machine. The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. New York: The Free Press, 1986).
Gobet, F. & Charness, N. (2018). Expertise in chess. In K. A. Ericsson, R. R. Hoffman, A. Kozbelt & A. M. Williams (Hg.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. 2. Auflage (597–615). Cambridge: Cambridge University Press.
Gruber, H., Harteis, C. & Rehrl, M. (2006). Professional Learning: Erfahrung als Grundlage von Handlungskompetenz. Bildung und Erziehung, 59, 193–203
Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. (2004). Communities of Networked Expertise: Educational and Professional Perspectives. Amsterdam: Elsevier
Hayes, John R. 1981. The Complete Problem Solver. Philadelphia, Pa: Franklin Institute Press. 978-0-89168-028-4
Honecker, Erich — zitiert in der Festansprache zum 40. Jahrestag der DDR, 7. Oktober 1989, glasnost.de — siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=VphPebctAsM
Hunt, Andrew. 2008. Pragmatic Thinking and Learning: Refactor Your ‘Wetware’. Pragmatic Programmers. Raleigh: Pragmatic. (daraus stammt die Dreyfus-Geschichte, p22ff)
“In the 1970s, the brothers Dreyfus (Hubert and Stuart) began doing their seminal research on how people attain and master skills.”
“Once upon a time, two researchers (brothers) wanted to advance the state of the art in artificial intelligence. They wanted to write software that would learn and attain skills in the same manner that humans learn and gain skill (or prove that it couldn’t be done). To do that, they first had to study how humans learn.”
“The Dreyfus brothers looked at highly skilled practitioners, including commercial airline pilots and world-renowned chess masters. Their research showed that quite a bit changes as you move from novice to expert. You don’t just “know more” or gain skill. Instead, you experience fundamental differences in how you perceive the world, how you approach problem solving, and the mental models you form and use. How you go about acquiring new skills changes. External factors that help your performance — or hinder it — change as well.
Unlike other models or assessments that rate the whole person, the Dreyfus model is applicable per skill. In other words, it’s a situational model and not a trait or talent model.”
Kruger, Justin, and David Dunning. n.d. ‘Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments (PDF Download Available)’. ResearchGate. Accessed 9 February 2017.
Lehmann, A. C. & Gruber, H. (2006). Music. In K. A. Ericsson, N. Charness, R. R. Hoffman & P. J. Feltovich (Hg.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (457–470). Cambridge: Cambridge University Press.
Neuweg, Georg Hans. 2020. “Etwas können. Ein Beitrag zu einer Phänomenologie der Könnerschaft” in: Georg Hans Neuweg; Rico Hermkes; Tim Bonowski (Hg.)Implizites Wissen Berufs- und wirtschaftspädagogische Annäherungen. 2020. ISBN: 9783763965953 — E-Book (PDF):ISBN: 9783763965953 — DOI: 10.3278/6004682w – wbv-open-access.de
Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.
Williams, A. M., Ford, P. R., Hodges, N. J. & Ward, P. (2018). Expertise in sport: Specificity, plasticity, and adaptability in high-performance athletes. In K. A. Ericsson, R. R. Hoffman, A. Kozbelt & A. M. Williams (Hg.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. 2. Auflage (653–673). Cambridge: Cambridge University Press.
Wir haben sie alle — doch entfliehen können wir nicht: strukturelle Denkfehler, kognitive Abkürzungen für schwierige Fragen. Praktische Vorurteile und blinde Flecken. Diese Folge diskutiert eine kleine Auswahl aus mehr als 180 dokumentierten biases und bietet Optionen um sich selbst auf die Schliche zu kommen.
In einer WeSession am 3.11.21 gab es dazu Bilder, formerly known as slides. Die Kurzfassung ist hier zu sehen.
Ariely, Dan, and Maria Zybak. 2008. Denken hilft zwar, nützt aber nichts: warum wir immer wieder unvernünftige Entscheidungen treffen. München: Droemer.
Dobelli, Rolf. 2014. Die Kunst Des Klaren Denkens. dtv.
Dörner, Dietrich. 2002. Die Logik des Mißlingens: strategisches Denken in komplexen Situationen. 15. Aufl. rororo science 19314. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Gigerenzer, Gerd. 1991. ‘How to Make Cognitive Illusions Disappear: Beyond “Heuristics and Biases”’. European Review of Social Psychology 2 (1): 83–115. https://doi.org/10.1080/14792779143000033.
Halo Effect und zur Anzahl Bomben, die Obama verantwortet:
Kahneman, Daniel. 2019. Schnelles Denken, langsames Denken. Translated by Thorsten Schmidt. 25. Auflage. München: Siedler.
Klein, Gary A. 2009. Streetlights and Shadows: Searching for the Keys to Adaptive Decision Making. Cambridge, MA: MIT Press.
Manoogian, John III, Buster Benson, and TilmannR. 2016. ‘Cognitive Biases Dendigramm’. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognitive_bias_codex_en.svg.
Miller, George A. 1956. ‘The Magical Number Seven, plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information.’ Psychological Review 63 (2): 81–97. https://doi.org/10.1037/h0043158.
Scullen, S. E., M. K. Mount, and M. Goff. 2000. ‘Understanding the Latent Structure of Job Performance Ratings’. The Journal of Applied Psychology 85 (6): 956–70.
Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. 1981. ‘The Framing of Decisions and the Psychology of Choice’. Science 211 (4481): 453–58. https://doi.org/10.1126/science.7455683.
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_kognitiver_Verzerrungen
Für welches Problem ist ‘diversity’ die Lösung? // ‘Für alles’ würden HRler, New Work-Jünger und so ziemlich alle politisch korrekten Social Media animals antworten? // Macht Vielfalt ein Team besser, erfolgreicher, kreativer. Gemach … die Sozialforschung hat kaum Evidenzen, tendenziell leicht negative. (…)
Eine etwas umfangreichere Quellenliste und erneut: Verbeugung an @titiatscriptor — für die Steilvorlage zu dieser Tiefbohrung.
Wie Gefühle gemacht werden. // Woher kommen unsere Emotionen? // Und können wir ihnen trauen? // Grundlage ist ein feines Buch von Lisa Feldman-Barret »How Emotions are made«. Entlang an diesem roten Faden kommen erstaunliche Umstände zu Tage. (…)
Wie “die Wirtschaft Arbeitsgefühle erzeugt” ist der Untertitel des Buchs “Faktor Freude” von Sabine Donauer. // Jungwirth und Knecht sprechen am roten Faden der Geschichte über einige bedenkliche Reminiszenzen und Pendelbewegungen aus der Arbeits- und Industriegeschichte // von Gefühlsbewirtschaftung bei Taylor über das Göring-Institut bis nicht ganz in die Gegenwart des Feelgood-Managements // eine erstaunliche Achterbahnfahrt durch die Jahrzehnte (…)
Gefühle haben in der Arbeitswelt nichts zu suchen – ist das so? // Professionell sein, heißt, die Contenance zu bewahren. Echte Profis bleiben sachlich, cool und haben ihre Emotionen im Griff. // Zweiteilig – weil nicht alles in eine Folge passte (…)
Florian Städtler interviewt Stefan Kühl. Der teilt zufälligerweise die Initialen mit @knechtomat, dazu auch die Vorliebe, Mythen und Illusionen zum Leben und Arbeiten in Organisationen ganz nüchtern und mit der Brille des Systemikers (…)
In dieser Sendung (das erste mal ohne Stefan Knecht) interviewt Ulrike Wolter Gitta Peyn zu FORMWELT, die sie mit dem Mathematiker Ralf Peyn als Programmiersprache für Sprache(n) und Bedeutung entwickelte. Für den Systemtheoretiker: ein semantisch und formal selbstgenügsames linguistisches System. (…)
Vertrauen am Berg: Auf Leben und Tod // Wie entsteht Vertrauen? // Bedingungsloses Vertrauen und wechselseitiger Vertrauensvorschuss // Binarität und die Unteilbarkeit von Vertrauen: Ein bisschen vertrauen kann ich nicht (…)
Die erste Ausgabe des gemeinsamen Podcast von Alexander Jungwirth und Stefan Knecht. Erkundet wird die Frage, weshalb Organisationsentwicklung der letzte heisse Scheiss ist – oder dafür gehalten wird. (…)
Das Gespräch mit Bruno Baketarić dreht um Methoden-Gläubigkeit und vermutete Kausalitäten // Kontext als Entscheidungsgrundlage für oder gegen eine Methode // Prozesse als Relikt der Industriegesellschaft // Kanban für Flow, Scrum für Iteration und Warum Veränderung so verdammt schwierig ist // Das gute Ende: Zutaten statt Rezepte (…)
So eine Art von “Clickbait”-Effekt erlebt man, wenn man einen Blog-Artikel mit “Du sollst nicht loben” oder “Lob – das süße Gift” betitelt. Das Anzweifeln von Sinn und Zweck des Lobs (gerne vermischt mit Begriffen wie Anerkennung, Wertschätzung oder auch Feedback) verstößt (…)
Ist “Burn-out” ein Euphemismus für die Krankheit Depression? // Das Risiko, im Job über (seine) Depression zu sprechen. // Kann man einem/einer Nicht-Depressiven diesen Zustand erklären, ihn zumindest beschreiben? // Am Anfang steht die Krankheitseinsicht // Depression ist eine Sau (…)
Thema ist Dunbar’s Number des Psychologen und Anthropologen Robin Dunbar von 1993, die die Anzahl gleichzeitig unterhaltbarer Beziehungen mit dem Neocortex in Verbindung bringt. // Stimmt’s …? (…)
Gerrit Beine im Trialog mit Stefan Knecht und Florian Städtler // “Selbst-Organisation”. Gar nicht so einfach, sich da nicht zu verzetteln: Funktionierende Selbst-Organisation beobachtet man “in so ziemlich jedem Unternehmen” (Gerrit) // Ohne Selbst-Organisation wäre ein Unternehmen zum Scheitern verurteilt (…)
Lob kann schaden: das ist so wunderbar kontra-intutitiv!// menschliche Leistung ist nur sehr schwer mess- und vergleichbar// Leistungsbewertungen bewirken eher das Gegenteil dessen, was sie erreichen wollen (…)
Eine Folge über Mythen und Wahrheiten // die breit vergebliche Suche nach Evidenzen im Change Management // die Naivität darüber, dass Wissenschaft Eindeutigkeit schafft (…)
VUKA ist redundant // Das K für ‘Komplexität’ reicht völlig // BANI bringt nichts — ausser einem weiteren Akronym (…)
Teamplay und (digitales) Solistentum / die Dekonstruktion des Teaming-Modelles von Bruce Tuckman (Storming, Forming, Norming, Performing) – das keine Evidenzen hat und auch ganz anders geschehen kann (…)
Der Soziologe Martin Schröder hat das sozio-ökonomisches Panel der SHELL-Studie nachgerechnet und demystifiziert die Generationen XYZ: Es gibt sie nicht // die gesamte Gesellschaft wird liberaler und mit ihr die Geburtskohorten (…)
Eine Folge über #wol, ‘Working out Loud’ und was geschieht, wenn man das ein wenig durchschüttelt (…) // Des Kaisers neue Kleider (…)
Es geht um Menschenbilder // Haltung (Mindset) // Bambus und Betonpfosten // Dass ein Agile Mindset es nicht braucht // Wie ‘fixed’ und ‘growth’ keinerlei Evidenz haben und dennoch gerne weitervertrieben werden (…)
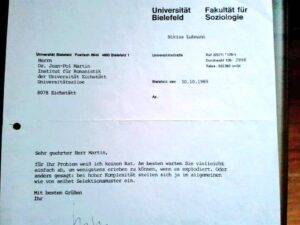
Ach, wissen Sie … man könnte so vieles sich ansehen und besser verstehen wollen. Hier eine rollierende Liste.
Wenn Sie Freude daran haben, sich ein solches oder anderes Thema gemeinsam anzusehen: geben Sie Laut. Gemeinsam macht das auch mehr Freude als alleine vor dem glühenden Monitor. Unten ↓ im Footer die Kontaktoptionen.
Das Wasserfall- oder V-Modell im konventionellen Projektmanagement: vor dessen Einsatz sein Miterfinder eindrücklich warnte. Nutzte nichts, wer liest schon das Kleingedruckte?
Ob das allerdings noch irgendjemanden interessiert …? Macht nicht die ganze Welt schon längst agil?
Oh, wait.