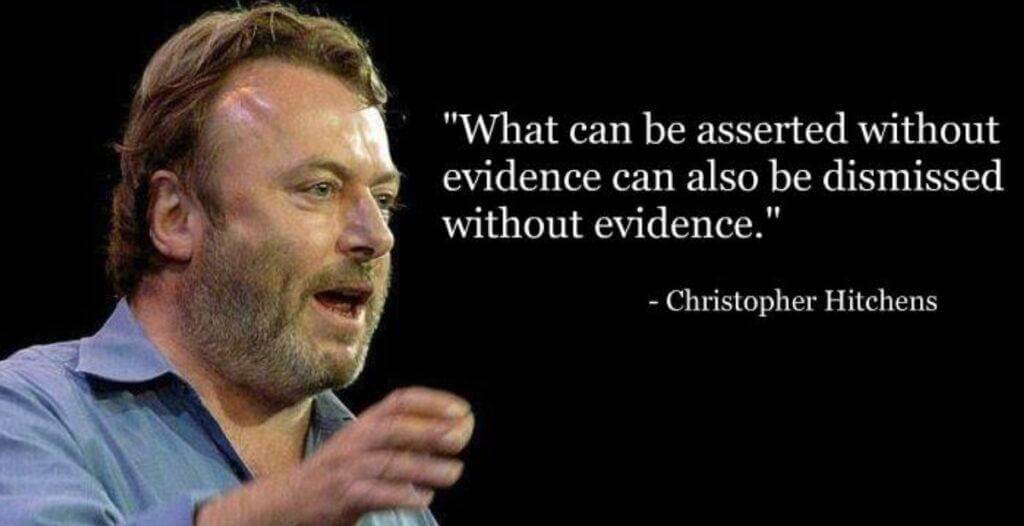Falsifizierbare Behauptungen können durch Beweise widerlegt werden. Es muss möglich sein, einen Beweis zu finden, der die Behauptung widerlegt. Wenn die Behauptung wahr ist, können Beweise sie nicht widerlegen. Gelingt eine Widerlegung nicht, dann kann diese Behauptung als vorläufig wahr akzeptiert werden.
Unfalsifizierbare Behauptungen sind immun gegen Beweise. Sie
könnten wahr sein, da es aber keine Möglichkeit gibt, die Behauptung zu überprüfen, sind alle “Beweise”, die die Behauptung zu stützen scheinen, nutzlos.
Vier Arten von Behauptungen sind nicht falsifizierbar:
- Subjektive Behauptungen, beruhen auf persönlichen Vorlieben, Meinungen, Werten, Ethik, Moral, Gefühlen und Urteilen.[4]
- Übernatürliche Behauptungen berufen sich auf Wesenheiten wie Götter und Geister, unbestimmte Energien und Kräfte und magische menschliche Fähigkeiten wie übersinnliche Kräfte. Per Definition geht das Übernatürliche über das Natürliche und Beobachtbare hinaus und ist daher nicht falsifizierbar. Das bedeutet nicht, dass diese Behauptungen zwangsläufig falsch oder wahr sind, sondern dass es keine Möglichkeit gibt, Beweise zu sammeln, um sie zu überprüfen. Es gibt Fälle, in denen übernatürliche Behauptungen falsifizierbar sind.[5] Auch Behauptungen über übernatürliche Ereignisse, die physische Beweise hinterlassen, können geprüft werden.[6]
- Vage Behauptungen, die unbestimmt oder unklar formuliert sind. Beispiele sind Horoskope[7] oder viele Behauptungen alternativer Medizin.[8] Obwohl diese pauschalen Behauptungen aufgrund ihrer Zweideutigkeit im Grunde bedeutungslos sind, werden sie oft falsch interpretiert und führen zu dem falschen Schluss, dass die so beworbenen Produkte wirksam sind.
- Ad-hoc-Ausreden sind Rationalisierungen und Verschiebungen um Beobachtungen zu erklären, die die Behauptung widerlegen könnten.
Falsche Überzeugungen werden geschützt, indem Wege gefunden werden, sie unbeweisbar zu machen, Beweise geleugnet werden oder die Behauptung als “Meinung” bezeichnet wird.
So kann eine Hellseherin eine ungenaue Prognose damit abtun, dass ihr “Energielevel” zu niedrig war. Oder ein Akupunkteur entschuldigt eine unwirksame Behandlung damit, dass die Nadeln nicht richtig entlang der Meridiane des Patienten platziert wurden. Verschwörungstheoretiker behaupten, dass unterstützende Beweise vertuscht und widersprüchliche Beweise untergeschoben wurden.
Falsifizierbarkeit bedeutet: Beweise sind wichtig. Eine nicht widerlegbare Behauptung ist deshalb nicht zwingend wahr.
Logik
Die Argumente für die Behauptung müssen logisch sein.
Argumente bestehen aus einer Schlussfolgerung (Behauptung) und einer oder mehreren Prämissen, die Beweise oder Unterstützung für die Behauptung liefern. Die Schlussfolgerung ist also eine Überzeugung, und die Prämissen sind die Gründe, warum wir diese Überzeugung haben. Viele Argumente enthalten auch notwendige versteckte oder unausgesprochene Annahmen damit die Schlussfolgerung wahr ist — und die daher bei der Bewertung von Argumenten erkannt werden müssen.
Induktion und Deduktion
Es gibt zwei Arten von Argumenten, die sich im Grad der Unterstützung für eine Schlussfolgerung unterscheiden.
Deduktive Argumente bieten schlüssige Unterstützung für die Schlussfolgerung. Sie sind gültig, wenn aus den Prämissen die Schlussfolgerung folgen muss und stichhaltig, wenn das Argument gültig ist und die Prämissen wahr sind. Damit die Schlussfolgerung als wahr angesehen werden kann, muss das Argument also sowohl gültig wie stichhaltig sein.
[9]
“Gültig” bedeutet in der Gebrauchssprache “wahr”. In der Argumentation bedeutet gültig jedoch, dass die Schlussfolgerung aus den Prämissen folgt, unabhängig davon, ob die Prämissen wahr sind oder nicht.
[10]
Induktive Argumente bieten verschieden
wahrscheinliche Unterstützung für die Schlussfolgerung. Im Gegensatz zu deduktiven Argumenten, die eine Schlussfolgerung garantieren, wenn das Argument sowohl gültig als auch stichhaltig ist, bieten induktive Argumente nur unterschiedliche Grade der Unterstützung für eine Schlussfolgerung. Induktive Argumente, deren Prämissen wahr sind und eine angemessene Unterstützung bieten, gelten als stark, während solche, die keine angemessene Unterstützung für die Schlussfolgerung bieten, als schwach gelten.
[11]
Logische Irrtümer
Logische Irrtümer sind Argumentationsfehler, die ein Argument abschwächen oder ungültig machen. Häufig sind:
- Ad hominem: diskreditiert ein Argument durch einen Angriff auf die Person des Vortragenden.
- Berufung auf eine (falsche) Autorität: stützt sich auf Aussagen einer als glaubwürdig dargestellten Person.
- Emotionaler Appell: Versuch der Argumentation über Emotionen (wie Wut, Angst, Freude oder Mitleid) anstelle über Vernunft oder Fakten zu überzeugen.
- Gesunder Menschenverstand: Behauptet, dass eine Behauptung wahr ist, weil viele Menschen sie glauben.
- Natürlichkeit: etwas sei gut oder besser, weil es natürlich ist.[12]
- Traditionsappell: Behauptet, dass etwas gut oder wahr ist, weil es seit langem so ist.
- Falsche Wahl: Es werden nur zwei Optionen angeboten, obwohl es wahrscheinlich viele weitere gibt.
- Voreilige Verallgemeinerung: Zieht eine weitreichende Schlussfolgerung aus kleiner Stichprobengröße.
- Verwechslung von Korrelation mit Kausalität: aus dem gleichzeitigen Auftreten zweier Ereignisse wird ein kausaler Zusammenhang abgeleitet.
- Red Herring: Versuch der Irreführung oder Ablenkung durch Bezugnahme auf irrelevante Informationen.
- Single Cause: Vereinfacht ein komplexes Problem auf eine einzige Ursache.
- Schlüpfriger Abhang (Slippery Slope): Hinweis auf eine Kettenreaktion mit extremen, unerwünschtem Ergebnis.
- Strohmann: Stellt das Argument eines anderen falsch dar, um es leichter abtun zu können.
Objektivität
Die Beweise für eine Behauptung müssen aufrichtig bewertet werden. Jeder ist anfällig für Denkfehler, die zu falschen Schlussfolgerungen verleiten können. Bedrohen Beweise eine tief verwurzelte, für unsere Identität wesentliche Überzeugung, dann suchen wir eher nach bestätigenden Belegen und ignorieren gegenläufige. Den eigenen Denkfehlern oder Biases gegenüber sind wir blind.
“Der erste Grundsatz ist, dass man sich nicht selbst täuschen darf, und man selbst ist am Leichtesten zu täuschen.” — Richard Feynman
Die häufigsten kognitiven Denkfehler (Biases) sind:
- Motivierte Argumentation: Emotional geprägte Suche nach Begründungen, die unterstützen, was wir für wahr halten.
- Bestätigungsvoreingenommenheit (Confirmation Bias): Tendenz, nach Informationen zu suchen und zu bevorzugen, die unsere Überzeugungen bestätigen.
- Overconfidence-Effekt: Tendenz zur Überschätzung unseres Wissens und/oder unserer Fähigkeiten.
Objektivität ist das vermutlich schwierigste Gebot. Kognition umfasst auch die Tendenz der Selbsttäuschung und Verstärkung persönlicher Überzeugungen und mittelbar zur Stärkung sozialer Bindung an Gruppen.
Pseudowissenschaft und Wissenschaftsleugnung
Beide gehen von einer gewünschten Schlussfolgerung aus, arbeiten sich rückwärts vor und selektieren dabei unterstützende Beweise und ignorieren Widersprüche. Es gibt jedoch entscheidende Unterschiede:
Pseudowissenschaftliches Denken sind Überzeugungen oder Praktiken, die als wissenschaftlich dargestellt werden, es aber nicht sind. Sie sind durch den Wunsch motiviert, etwas für wahr zu halten wenn und
weil es mit den bestehenden Überzeugungen oder Wunschdenken übereinstimmt. Die Anforderungen an die Qualität von Belegen ist folgerichtig sehr niedrig.
Wissenschaftsverweigerung leugnet anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse weil diese mit der eigenen Identität oder Überzeugungen kollidieren. Die Anforderungen an Belege werden unerreichbar hoch angesetzt.
[13] In beiden Fällen ist der Glaube im Recht zu sein und der Wunsch, eigene Überzeugungen zu schützen so stark, dass die eigenen Denkfehler nicht erkannt werden.
Für eine objektive Bewertung von Beweisen ist damit auf den eigenen Denkprozess zu achten. Beachten Sie alle Belege — auch und gerade die widersprüchlichen. Wenn die Beweise dafür sprechen, ändern Sie Ihre Meinung. Es hilft, die eigene Identität zu kennen und von eigenen Überzeugungen zu trennen: zuwiderlaufende Belege fühlen sich dann nicht wie ein persönlicher Angriff an. Auch hilft, sich nicht in ein Meinungslager zu begeben sondern sich wie ein Schiedsrichter zu verhalten.
Alternative Erklärungen
Andere Erklärungsmöglichkeiten für Beobachtungen müssen in Betracht gezogen werden auch wenn die favorisierte Erklärung von einer vertrauten Person stammt oder zu den eigenen Überzeugungen passt.
Was könnte noch die Ursache sein? Könnte es mehr als eine Ursache geben? Oder könnte es sich um einen Zufall handeln? Es gilt, viele (falsifizierbare) Erklärungen zu betrachten und jede dieser Erklärungen mit Belegen objektiv zu widerlegen. Was ist die wahrscheinlichste Erklärung? Hilfreich ist Occams Rasiermesser:
Die wahrscheinlich richtige Erklärung ist jene, die die wenigsten neuen Annahmen erfordert.
Außergewöhnliche Behauptungen benötigen auch außergewöhnliche Beweise.
[14]
Vorläufige Schlussfolgerungen
Wissenschaftlich Denken heisst: jede Schlussfolgerung kann sich mit neuen Beweisen ändern. Wissenschaftliche Schlussfolgerungen sind immer vorläufig. Jede weitere Studie ist ein Teil eines größeren Puzzles mit unbekannt vielen Teilen, das mit jedem Teilchen klarer wird und Unsicherheit verringert.
Einige wissenschaftlich gewonnenen Schlussfolgerungen sind stabiler als andere. Erklärungen, die durch eine große Anzahl von Beweisen gestützt werden, sind Theorien. Da die Beweise für viele Theorien so überwältigend sind und von vielen verschiedenen unabhängigen Forschungslinien stammen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie widerlegt werden – auch wenn sie mit neuen Beweisen möglicherweise angepasst werden.
Dies bedeutet nicht, dass wissenschaftliche Erkenntnisse unglaubwürdig sind. Im Gegenteil: Wissenschaft beruht auf Bescheidenheit und der Bereitschaft und Fähigkeit zu lernen. Zum kritischen Denken gehört auch zu lernen, mit Mehrdeutigkeit und Unsicherheit umzugehen. Wissen ist nicht schwarz oder weiß sondern ein Grauspektrum.
Evidenz
Beweise für eine Behauptung müssen zuverlässig, umfassend und ausreichend sein. Je mehr und je besser Belege sind, desto eher kann eine Behauptung akzeptiert werden. Die Qualität von Evidenzen wird nach diesen Überlegungen beurteilt:
Beweise müssen verlässlich sein
Mit welcher systematischen Methode wurden die Belege generiert? Studien unterscheiden sich qualitativ. Anekdoten und Erfahrungsberichte sind am wenigsten zuverlässig und nie ausreichend. Beobachtungen sammeln Daten aus der realen Welt und können Korrelationsbeweise bieten, kontrollierte Studien können Kausalbeweise liefern. Höchste Evidenz haben Meta-Analysen und systematische Übersichten, die das Gesamtbild aller vorliegenden Fakten betrachten.
Quelle der Informationen und Daten
Die zuverlässigsten Quellen sind Fachzeitschriften mit Peer-Review, seriöse wissenschaftliche Organisationen und staatliche Einrichtungen. Die zweitzuverlässigsten Quellen sind hochwertige journalistische Veröffentlichungen, die nachweislich genau berichten. YouTube-Kanäle gehören nicht dazu, ebenso wenig Social Media ohne Quellenangabe. Fachexperten mit Hintergrundwissen sind qualifizierter als Laien. Wenn Experten einen Konsens erzielt haben, ist dies das zuverlässigste Wissen.
Beweise müssen umfassend sein
Ein einziges Puzzleteilchen, eine einzige versehentlich oder absichtlich selektierte Studie kann das wahre Gesamtbild verzerren.
[15] Sehr starke Schlussfolgerungen entstehen durch unabhängige und konsistente Beweislinien.
Beweise müssen ausreichend sein
Um die Wahrheit einer Behauptung zu beweisen, müssen die Beweise ausreichend sein. Behauptungen, die ohne Beweise aufgestellt werden, bieten keinen Grund zur Annahme und können zurückgewiesen werden. Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise. Grundsätzlich gilt: Je unplausibler oder ungewöhnlicher eine Behauptung, desto mehr Beweise sind erforderlich, um sie zu akzeptieren.
[16] Behauptungen begründet allein auf der Autorität einer Person sind niemals ausreichend: Fachwissen ist wichtig und gerade Experten sollten Beweise vorlegen. “Weil ich es sage” und Anekdoten sind nie ausreichend. Persönliche Geschichten können ebenso eindrucksvoll wie unzuverlässig sein.
Replizierbarkeit
Replizierbarkeit bedeutet in einfachster Lesart, unabhängig von Experimentator und Methode zu einer ähnlichen Schlussfolgerung zu gelangen und so Zufälle, Fehler oder Betrug zu verhindern.
Ziel von Wissenschaft ist es, die Natur zu verstehen. Die Natur ist konsistent; daher sollten auch Versuchsergebnisse konsistent sein. Durch mehrere Studien unabhängig generierte Ergebnisse sind verlässlicher.
Referenzen und Bemerkungen
- Beispiele sind verschiedene Formen der Alternativmedizin, Kryptozoologie, viele New-Age-Überzeugungen und das Paranormale.↩︎
- Trecek-King, Melanie. 2022. „A Life Preserver for Staying Afloat in a Sea of Misinformation | Skeptical Inquirer“. Skeptical Inquirer, 28. Februar 2022. URL. Ausgang ist Trecek-King, Melanie. 2022. Teach skills, not facts. Skeptical Inquirer 46(1): 39–42. URL↩︎
- Lett, James. 1990. A field guide to critical thinking. Skeptical Inquirer 14(2): 153–160. URL Lett entwickelte das FiLCHeRS-Modell, es steht für Falsifiability, Logic, Comprehensiveness of evidence, Honesty, Replicability and Sufficiency of evidence. ↩︎
- Beispiel: ich mag glauben, dass Katzen die besten Haustiere sind und dass Gesundheitsfürsorge ein Menschenrecht ist, aber keine dieser Behauptungen ist falsifizierbar, egal wie viele Fakten oder Beweise ich zu ihrer Rechtfertigung anführe.↩︎
- Beispiel: Behauptet ein Hellseher, die natürliche Welt in irgendeiner Weise beeinflussen zu können, z.B. Gegenstände zu bewegen/zu verbiegen oder Gedanken zu lesen, können wir die Fähigkeiten des Hellsehers unter kontrollierten Bedingungen testen.↩︎
- So behaupten zum Beispiel die young earth-Kreationisten, dass der Grand Canyon während Noahs Flut vor etwa 4.000 Jahren entstanden ist. Eine globale Flut würde geologische Beweise hinterlassen, wie z. B. massive Erosionsmerkmale und Sedimentablagerungen. Es überrascht nicht, dass das Fehlen solcher Beweise diese Behauptung widerlegt. Doch selbst wenn die Beweise auf eine globale Flut vor nur ein paar tausend Jahren hindeuten würden, könnten wir die Behauptung, dass ein Gott die Ursache war, nicht widerlegen.↩︎
- Ihr Horoskop für heute sagt: “Heute ist ein guter Tag zum Träumen. Vermeide es, wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Energie des Tages könnte neue Menschen in dein Leben bringen.” Da dieses Horoskop zweideutige und vage Begriffe wie “träumen”, “wichtig” und “könnte” verwendet, macht es keine konkreten, messbaren Vorhersagen. Da es offen für Interpretationen ist, könnten Sie sich selbst davon überzeugen, dass es mit dem übereinstimmt, was Ihnen im Laufe des Tages widerfahren ist, vor allem, wenn Sie den Tag besonders aufmerksam mit der Suche nach “Beweisen” verbringen. ↩︎
- Die so genannte “Energiemedizin”, wie Reiki und Akupunktur, beruht beispielsweise auf der Behauptung, dass Krankheiten durch aus dem Gleichgewicht geratene Energiefelder verursacht werden, die zur Wiederherstellung der Gesundheit reguliert werden können. Diese Energiefelder können jedoch nicht nachgewiesen werden und entsprechen keinen bekannten Energieformen.↩︎
- Beispiel: “Katzen sind Säugetiere. Charlie ist eine Katze. Daher ist Charlie ein Säugetier.” Die Schlussfolgerung muss sich aus den wahren Prämissen ergeben. Da dieses Argument sowohl gültig als auch stichhaltig ist, müssen wir die Schlussfolgerung akzeptieren.↩︎
- Das folgende Beispiel ist gültig, aber nicht stichhaltig: “Katzen sind Bäume. Charlie ist eine Katze. Daher ist Charlie ein Baum.” Die Schlussfolgerung ist gültig, weil sie aus den Prämissen folgt, aber die Schlussfolgerung ist falsch, weil die Prämisse unwahr ist; Katzen sind keine Bäume.↩︎
- Beispiel: “Charlie ist eine Katze. Charlie ist orange. Daher sind alle Katzen orange.” Selbst wenn die Prämissen wahr sind (und das sind sie), bietet eine Stichprobengröße von einer Katze keine angemessene Unterstützung für die Verallgemeinerung auf alle Katzen: es handelt sich um ein schwaches Argument.↩︎
- Beispiel: “Nestlé-Lebensmittel sind ungesund, weil sie nicht natürlich sind.” Die Schlussfolgerung lautet: “Nestlé-Lebensmittel sind ungesund”, und die erklärte Prämisse lautet: “Sie sind nicht natürlich.” Dieses Argument hat eine versteckte Prämisse, nämlich “Dinge, die nicht natürlich sind, sind ungesund”, was auf den Trugschluss der Natürlichkeit hinausläuft. Wir können nicht davon ausgehen, dass etwas aufgrund seiner vermeintlichen Natürlichkeit gesund oder ungesund ist. (Arsen und Blei sind natürlich, aber keines von beiden ist gut für uns!) Indem wir die versteckte Prämisse explizit benennen und den Fehler in der Argumentation erkennen, sehen wir, dass wir dieses Argument zurückweisen sollten.↩︎
- Beispiele: die Leugnung des vom Menschen verursachten Klimawandels, die Evolution oder die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen.↩︎
- Beispiel: Sie finden Morgens eine Glasscherbe auf dem Boden. Einbrecher? Könnte es ein Geist gewesen sein? Oder vielleicht war es die Katze? Sie suchen nach anderen Anzeichen dafür, dass jemand in Ihrem Haus war, z.B. ein zerbrochenes Fenster oder fehlende Gegenstände; ohne andere Beweise scheint die Erklärung Einbrecher unwahrscheinlich. Die Erklärung mit den Geistern erfordert eine völlig neue Annahme, für die wir derzeit keine Beweise haben: die Existenz von Geistern. Es ist zwar möglich, dass ein Gespenst in der Nacht in Ihrem Haus war, aber ein Geist, der das Glas zerbricht, erscheint noch unwahrscheinlicher als ein Einbruch weil sie zusätzliche, unbewiesene Annahmen erfordert, für die es keine außergewöhnlichen Beweise gibt. Sie sehen Ihre Katze, die Sie dabei beobachtet, wie Sie Glasscherben vom Boden entfernen, und erinnern sich daran, dass sie Gegenstände umgestoßen hat. Sie haben keinen eindeutigen Beweis, aber es war wahrscheinlich die Katze.↩︎
- Beispiel: alles Lebendige braucht flüssiges Wasser. Der Mensch kann nur drei oder vier Tage ohne Wasser leben. Wenn alle Serienmörder zugegeben haben, Wasser zu trinken — welchen Beleg generiert das? ↩︎
- Beispiel: Sie sind Unternehmer und Paula arbeitet für Sie. Eine hervorragende Mitarbeiterin, die immer pünktlich ist und immer gute Arbeit leistet. Eines Tages kommt Paula zu spät zur Arbeit. Wenn Paula Ihnen erzählt, dass ihr Auto eine Panne hatte, werden Sie ihr höchstwahrscheinlich glauben. Sie haben keinen Grund, ihr nicht zu glauben – auch wenn Sie, wenn Sie wirklich streng sind, vielleicht eine Quittung des Abschleppwagens verlangen. Aber was ist, wenn Paula Ihnen sagt, dass sie zu spät kommt, weil sie von Außerirdischen entführt wurde? Das ist eine außergewöhnliche Behauptung, und Paula trägt die Beweislast. ↩︎